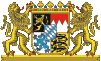Rückblick auf den Journalisten-Workshop am 04. Mai 2018
Mythen & Fakten in der Ernährung – Lebensmittelverschwendung

©wernerimages/Fotolia.com
Im Fokus des Journalisten-Workshops 2018 stand die Lebensmittelverschwendung. Die Leitfrage war, wie sich Mythen im Themengebiet Lebensmittelverschwendung von Fakten unterscheiden lassen – und wie mithilfe des Storytellings HeldInnen identifziert werden können, um komplexe Zusammenhänge und zahlenlastige Fakten auch wirklich an die Zielgruppe zu bringen.
Unter den ReferentInnen waren Valentin Thurn, Regisseur des Films "Taste the Waste", der FAZ-Journalist Jan Grossarth, Dominik Leverenz von der Universität Stuttgart sowie Dr. Felicitas Schneider vom Thünen-Institut.
Mythen und Fakten
Zahlen, Fakten und Lebenmittelretter-HeldInnen
Storytelling: Geschichten brauchen HeldInnen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Marie Lampert berichtet, wie Storytelling geht
Der Regisseur und Buchautor Valentin Thurn wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt mit seinen Filmen „Taste the waste“ und „10 Milliarden – wie werden wir alle satt?“ sowie den dazugehörigen Büchern. Neben seinem Engagement als Regisseur und Buchautor gründete er 2012 den Verein Foodsharing, um das Thema Lebensmittelverschwendung nicht nur zu dokumentieren, sondern auch aktiv anzugehen. Er berichtete von der Recherche zu seinem Film: Bevor dieser 2010 ins Kino kam, lagen noch keine Zahlen zur Lebensmittelverschwendung in Deutschland vor. Daher verwendete er Zahlen aus Großbritannien und Österreich – die sich im Nachhinein als recht zutreffend erwiesen.
"Es fehlt eine Strategie, wie Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbiert werden soll"

Valentin Thurn zeigt Beispiele aus seinem Film "Taste the waste"
Definition von Lebensmittelabfällen
Vorschlag einer einheitlichen Definition von Lebensmittelabfällen auf europäischer Ebene (veröffentlicht mit dem Definitional Framework for Food Waste des EU-Forschungsprojektes FUSIONS):
„Lebensmittelabfall ist jedes Lebensmittel, sowie dessen ungenießbarer Anteil, welches der Lebensmittelwertschöpfungskette zur Rückgewinnung oder Entsorgung entnommen wird (einschließlich kompostierte Lebensmittel, untergepflügte Pflanzen, nicht geerntete Pflanzen, anaerobe Gärung, Bio-Energie Produktion, Verbrennung, Entledigung in Kanalisation, Mülldeponie oder Einleitung ins Meer).“ (Östergren, et al., 2014)
"Einheitliche Definitionen sind wichtig"
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Christine Röger (KErn) im Gespräch mit Dominik Leverenz (Uni Stuttgart)
"Wertschätzung von Lebensmitteln als Gegentrend zur Individualisierung"
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Jan Grossarth berichtet über seine Medienanalyse
Initiativen, Netzwerke und Apps gegen Lebensmittelverschwendung
"Es gibt viele Maßnahmen und Mittel, um die Welt zu retten"

Dr. Felicitas Schneider vom Thünen-Institut
Links:
Lisa Zvonetskaya stellte die von ihr entwickelte App UXA vor. In der App können die Nutzer Reste von Mahlzeiten oder Lebensmitteln einstellen, die sie selbst nicht aufbrauchen können. Die Kontaktaufnahme machen die Nutzer selbst aus. Angezeigt wird ein Umkreis bis zu 50 Kilometer.
Franziska Lienert stellte die international erfolgreiche App Tood Good To Go vor. Diese richtet sich an Unternehmen im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung. Beispielsweise können Hotels Buffet-Reste via die App vermitteln. Die Unternehmen verdienen noch etwas und müssen die Reste nicht entsorgen und die Kunden kommen günstig an hochwertige Lebensmittel, laut Lisa Kleinert eine Win-win-win-Situation. Die App kommt ursprünglich aus Dänemark und hat aktuell 8.000 NutzerInnen in Deutschland.
Michael Spitzenberger stellte das Netzwerk "unser täglich Brot" vor. Die Idee dahinter ist, dass altes, und noch gutes, Brot nicht weggeschmissen werden muss, sondern an interessierte Unternehmen weiterverkauft wird. Die Bäckerei erhält 10 Prozent des Umsatzes. Brot retten? Ährensache.